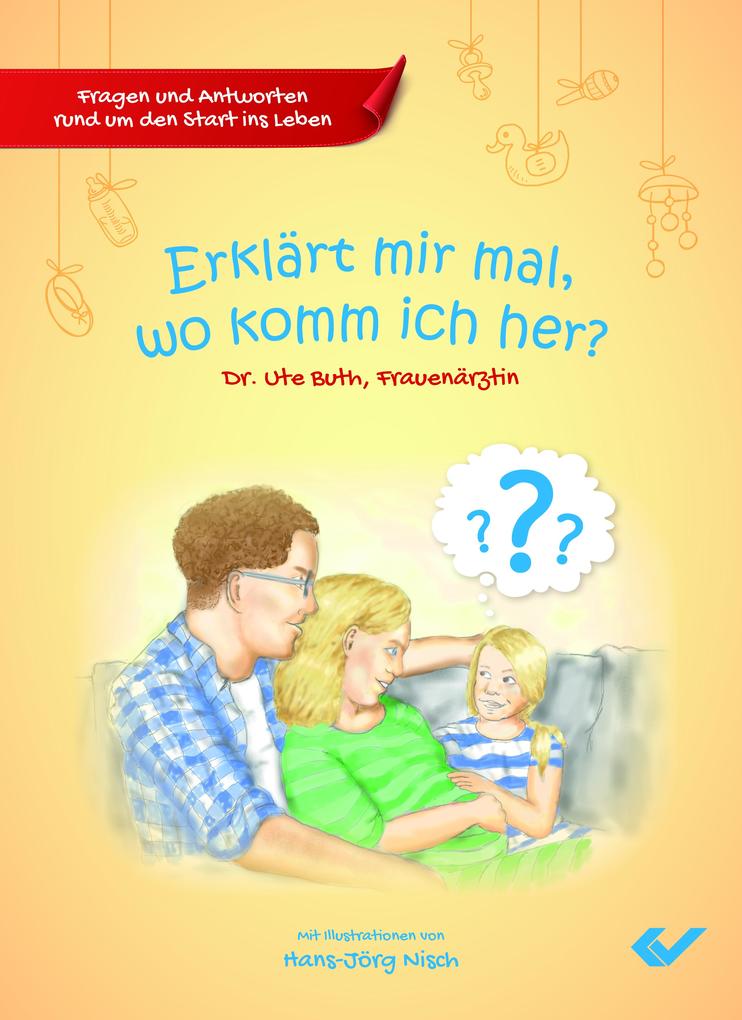„Was ist der Mensch?“, auch wenn man in religiösen Werken vornehmlich Bücher sucht, die der Frage nachgehen, „Was Gott sei“, lässt sich nicht die Bedeutung der Lehrevom Menschen leugnen. Wie wir diese Frage beantworten, wird weitreichenden Einflüsse auf unser Denken und Leben haben.
„Was ist der Mensch?“, auch wenn man in religiösen Werken vornehmlich Bücher sucht, die der Frage nachgehen, „Was Gott sei“, lässt sich nicht die Bedeutung der Lehrevom Menschen leugnen. Wie wir diese Frage beantworten, wird weitreichenden Einflüsse auf unser Denken und Leben haben.
Anthony A.Hoekema (1913-1988), langjähriger Dozent für systematische Theologie am Calvin Colege hat in den späten 80ern mit „Created in God’s Image“ (z.B. für 19,99$ bei logos erhältlich) ein überraschend leicht zugängliches Werk zu diesem Thema Thema geschrieben.
Das der Mensch als bzw. zum Bilde Gottes geschaffen ist, ist zentraler Ausgangspunkt für Hoekemas Überlegungen. Zunächst arbeitet er hinaus, was es bedeutet, dass der Mensch eine „geschaffene Person/Persönlichkeit“ ist:
„Der Mensch ist aber nicht nur ein Geschöpf, er ist auch eine Person. Und eine Person zu sein bedeutet, eine Art von Unabhängigkeit zu haben – nicht absolut, sondern relativ. Eine Person zu sein bedeutet, in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, Ziele zu setzen und sich in Richtung dieser Ziele zu bewegen. Es bedeutet, Freiheit zu besitzen – zumindest in dem Sinne, dass man in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Der Mensch ist kein Roboter, dessen Weg vollständig von äußeren Kräften bestimmt wird; er verfügt über die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Selbststeuerung. Ein Mensch zu sein bedeutet, um es mit Leonard Verduins malerischem Ausdruck zu sagen, ein „Geschöpf der Optionen“ zu sein.“ (S.5-6; eigene Übersetzung)
 Ich bin auf diesen Buchhinweis von Daniel auf philemonblog.de gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten wollte (Ich empfehle auch diesen Artikel von
Ich bin auf diesen Buchhinweis von Daniel auf philemonblog.de gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten wollte (Ich empfehle auch diesen Artikel von  Mittlerweile ist es kaum zu vermeiden, dass man mit der gendergerechten Sprache konfrontiert wird und in immer mehr Texten Schreibweisen wie Kund:innen oder Verkäufer:innen liest. Ich vermute, dass vielen Eltern – egal ob Christen oder Nicht-Christen – überhaupt nicht bewusst ist, wie gezielt wir und vor allem die nächste Generation mit dieser Ideologie indoktriniert werden.
Mittlerweile ist es kaum zu vermeiden, dass man mit der gendergerechten Sprache konfrontiert wird und in immer mehr Texten Schreibweisen wie Kund:innen oder Verkäufer:innen liest. Ich vermute, dass vielen Eltern – egal ob Christen oder Nicht-Christen – überhaupt nicht bewusst ist, wie gezielt wir und vor allem die nächste Generation mit dieser Ideologie indoktriniert werden.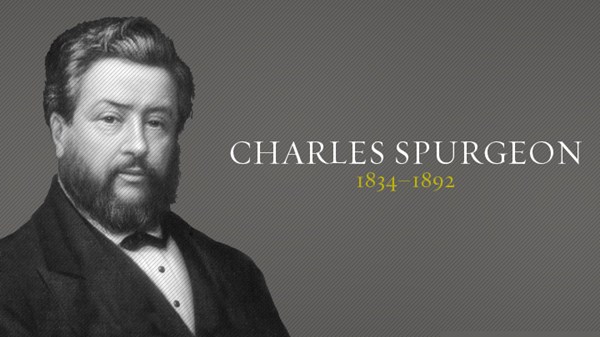
 In einem sehr persönlichen Brief schildert Hudson Taylor, wie er im Kampf um die Heiligung Christus neu als Erretter erlebt hat (
In einem sehr persönlichen Brief schildert Hudson Taylor, wie er im Kampf um die Heiligung Christus neu als Erretter erlebt hat ( Sinclair Ferguson ist mit „The Whole Christ“ in mehrfacher Hinsicht ein Spagat gelungen. Einerseits gelingt es ihm, eine trocken wirkende Debatte der schottischen Presbyterianer im 18ten Jahrhundert in unsere Zeit zu holen. Dabei erweist er sich als Experte in den Lebensläufen vieler Puritaner und der Gläubigen Schottlands. Seine Detailangaben erleichtern dabei den Lesefluss und öffnen mit diesen Darstellungen eine weite Tür in das bunte und lebendige Werk der Puritaner (Ich denke persönlich, dass ihm das sogar viel besser gelingt als z.B. Beeke in der „Puritan Theology“). Doch worum ging es bei dieser Debatte, die als „the Marrow Controversy“ bis heute fast jeden Theologiestudenten Schottlands beschäftigt? Ferguson arbeitet die Relevanz der dahinterstehenden Frage heraus: Gibt es eine Bedingung, um zu Jesus zu kommen bzw. von seinen Segnungen zu profitieren. Wir kennen diese Frage oft im Rahmen der Frage: „Kann ich jedem sagen, dass Christus für ihn gestorben ist?“ Wer bis dahin dachte, dass es bloß ein calvinistisches Problem ist, wird von den Ausführungen Fergusons überrascht:
Sinclair Ferguson ist mit „The Whole Christ“ in mehrfacher Hinsicht ein Spagat gelungen. Einerseits gelingt es ihm, eine trocken wirkende Debatte der schottischen Presbyterianer im 18ten Jahrhundert in unsere Zeit zu holen. Dabei erweist er sich als Experte in den Lebensläufen vieler Puritaner und der Gläubigen Schottlands. Seine Detailangaben erleichtern dabei den Lesefluss und öffnen mit diesen Darstellungen eine weite Tür in das bunte und lebendige Werk der Puritaner (Ich denke persönlich, dass ihm das sogar viel besser gelingt als z.B. Beeke in der „Puritan Theology“). Doch worum ging es bei dieser Debatte, die als „the Marrow Controversy“ bis heute fast jeden Theologiestudenten Schottlands beschäftigt? Ferguson arbeitet die Relevanz der dahinterstehenden Frage heraus: Gibt es eine Bedingung, um zu Jesus zu kommen bzw. von seinen Segnungen zu profitieren. Wir kennen diese Frage oft im Rahmen der Frage: „Kann ich jedem sagen, dass Christus für ihn gestorben ist?“ Wer bis dahin dachte, dass es bloß ein calvinistisches Problem ist, wird von den Ausführungen Fergusons überrascht: