Ich habe mir „als Ostervorbereitung“ das Kapitel (II,16) über Jesu Leiden, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt sowie das Kapitel (III,25) über die Auferstehung der Toten in Calvins Institutio angeschaut und bin für die Nachfolge ermutigt und geistlich gestärkt worden. Interessanterweise fängt Calvin die Betrachung von Jesu Leiden mit der Frage an, warum es nötig ist, oder vielleicht besser formuliert: Wie wir in dem Leiden der Gnade Gottes teilhaftig werden. In II.16.2 bringt er eine wunderbare Ausführung, wie Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit durch das Opfer Christi uns erst kostbar wird. Ich zitiere ausführlich und wünsche allen Lesern ein gesegnetes Osterfest.
„Aber bevor wir weitergehen, müssen wir im Vorbeigehen der Frage nachsinnen, wie es sich denn miteinander vereinbaren lässt, dass Gott, der uns mit seinem Erbarmen zuvorgekommen ist, uns doch feind ist, bis er in Christus mit uns versöhnt ist! Denn wie hätte er uns in seinem eingeborenen Sohne eine solch einzigartige Bürgschaft seiner Liebe zu uns geben können, wenn er uns nicht schon zuvor in freier Gnade freundlich gesinnt gewesen wäre? Hier entsteht also wirklich der Schein eines Widerspruchs, und ich muss also diesen Knoten zu lösen versuchen. Der Heilige Geist sagt es in der Schrift etwa so: Gott ist den Menschen feind gewesen, bis sie durch Christi Tod bei ihm wieder zu Gnaden gekommen sind (Röm. 5,10). Oder wir hören auch, der Mensch sei unter dem Fluch, bis seine Ungerechtigkeit durch Christi Opfertod gesühnt sei (Gal. 3,10.13), oder auch, er sei von Gott getrennt, bis dass in Christi Leib die Gemeinschaft wiederhergestellt sei (Kol. 1,21f.). Diese und ähnliche Sprüche sind unserem Verständnis angepasst, damit wir besser erkennen, wie jämmerlich und notvoll unsere Lage ist außer Christus. Denn wenn es uns nicht mit klaren Worten gesagt würde, dass Gottes Zorn und Strafe und der ewige Tod auf uns gelegen, so würden wir weniger anerkennen, wie elend wir ohne Gottes Erbarmen wären, und das Geschenk der Befreiung weniger zu schätzen wissen! Ich will ein Beispiel bilden.
Es hört jemand: Wenn dich Gott, als du noch ein Sünder warst, so gehasst und dich so von sich gestoßen hätte, wie du es verdient hättest, so wärest du jämmerlich zugrunde gegangen; aber Gott hat dich von sich aus und in freiem Erbarmen in Gnaden angenommen, wollte dich nicht gänzlich verstoßen und rettete dich aus solcher Gefahr. Wer das hört, der wird gewiss davon innerlich betroffen, er wird auch zu einem gewissen Teil erwägen, was er also Gottes Erbarmen für Dank schuldig ist.
Aber wenn er nun auf der anderen Seite hört, was die Schrift lehrt: Du bist durch die Sünde wirklich von Gott abgekommen, bist ein Erbe des Zorns, bist dem Fluch des ewigen Todes verfallen, ausgeschlossen von jeder Hoffnung auf das Heil, fremd aller Segnung Gottes, Sklave des Satans, Gefangener unter dem Joch der Sünde, schrecklichem Verderben ausgeliefert, ja, schon mitten darin! — dann aber ist Christus als Fürsprecher ins Mittel getreten und hat die Strafe auf sich genommen, hat gelitten, was nach Gottes gerechtem Urteil alle Sünder leiden mussten, hat all das Böse, das sie vor Gott verhasst machte, mit seinem Blute gesühnt; und nun ist durch dieses Sühnopfer dem Vater Genüge getan, durch diesen Fürsprecher sein Zorn besänftigt, auf diesem Grund der Friede Gottes mit den Menschen fest gegründet, nun ruht auf dieser Verbindung Gottes Wohlgefallen gegen uns! — ich sage, wenn der Mensch das hört, wird er nicht um so tiefer das alles zu Herzen nehmen, je deutlicher und lebendiger ihm vor Augen gestellt wird, wie groß die Not ist, aus der ihn Gott herausreißt?
Kurz, wir sind ja von Natur gar nicht so beschaffen, dass wir nach dem Leben aus Gottes Barmherzigkeit recht verlangen und dafür genugsam danken können, wenn uns nicht zuvor der Schrecken vor dem Zorn Gottes und das Entsetzen vor dem ewigen Tode durch die Seele dringt und uns zu Boden wirft; und deshalb unterweist uns die göttliche Lehre derart, dass wir Gott als uns feindlich erblicken, seine Hand ausgereckt sehen, um uns zu verderben — aber doch nur, damit wir seine Freundlichkeit und seine Vaterliebe allein in Christus ergreifen! “

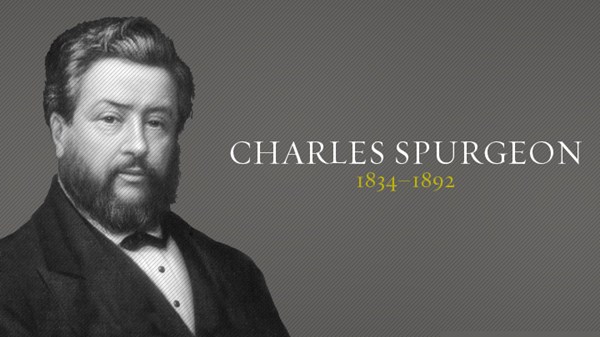
 Eigentlich ist es eine logische Schlussfolgerung von Luthers rigoroser Verteidigung von sola fide und sola gratia, dass man den Sinn des Gesetzes völlig in Frage stellt. So tat es auf jeden Fall auch Johannes Agricola, ein lutherischer Theologe, auf den Luther so viele Hoffnungen setzte, dass er ihn in seinem Heim in Wittenberg ließ, und sich von ihm selbst für Predigten und Vorlesungen vertreten ließ. Agricola war nun der Ansicht, dass die Predigt des Gesetzes für Christen unnötig ist, da man nun im neuen Bund, nämlich im Bund der Gnade lebt. Entsprechend gehören „das Gesetz Gottes bzw. die Zehn Gebote aus der Kirche (…) verstoßen und in das Rathaus (…)verwiesen;“
Eigentlich ist es eine logische Schlussfolgerung von Luthers rigoroser Verteidigung von sola fide und sola gratia, dass man den Sinn des Gesetzes völlig in Frage stellt. So tat es auf jeden Fall auch Johannes Agricola, ein lutherischer Theologe, auf den Luther so viele Hoffnungen setzte, dass er ihn in seinem Heim in Wittenberg ließ, und sich von ihm selbst für Predigten und Vorlesungen vertreten ließ. Agricola war nun der Ansicht, dass die Predigt des Gesetzes für Christen unnötig ist, da man nun im neuen Bund, nämlich im Bund der Gnade lebt. Entsprechend gehören „das Gesetz Gottes bzw. die Zehn Gebote aus der Kirche (…) verstoßen und in das Rathaus (…)verwiesen;“
 Auf diesen Auszug aus den Bekenntnissen von Augustinus bin ich durch eine sehr gelungen Predigt von
Auf diesen Auszug aus den Bekenntnissen von Augustinus bin ich durch eine sehr gelungen Predigt von 
 Carl Trueman hat einen Band zur fünfbändigen Reihe „5 Solas Series“ von Herausgeber
Carl Trueman hat einen Band zur fünfbändigen Reihe „5 Solas Series“ von Herausgeber